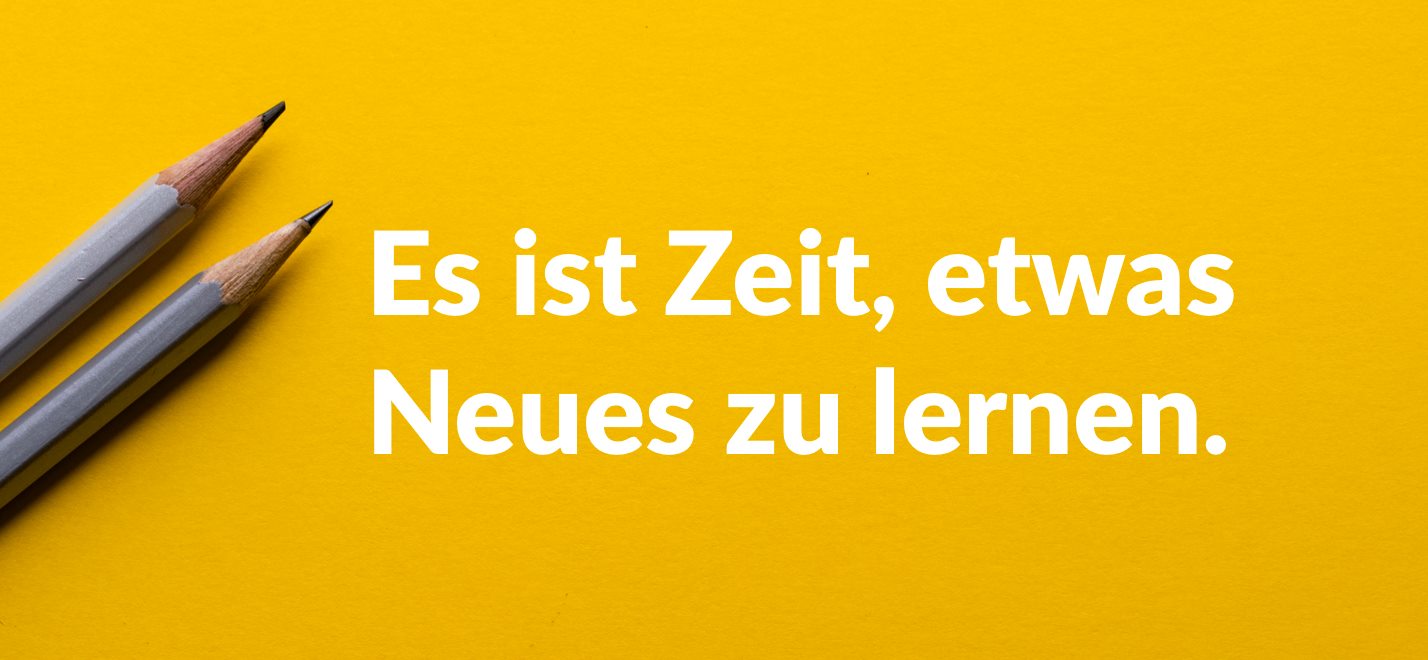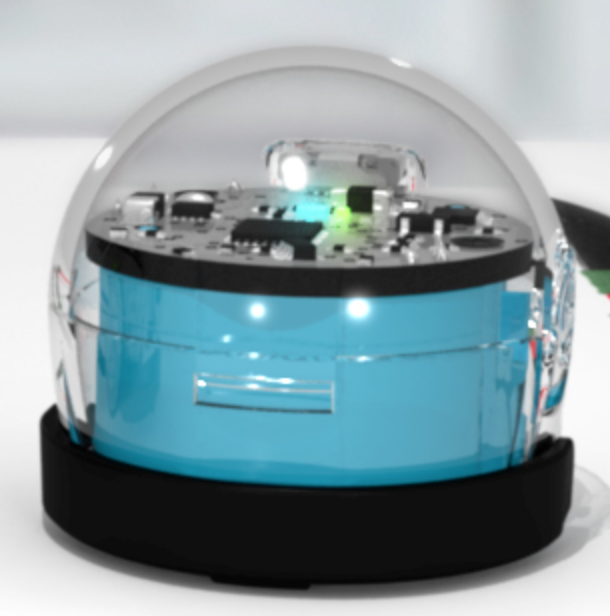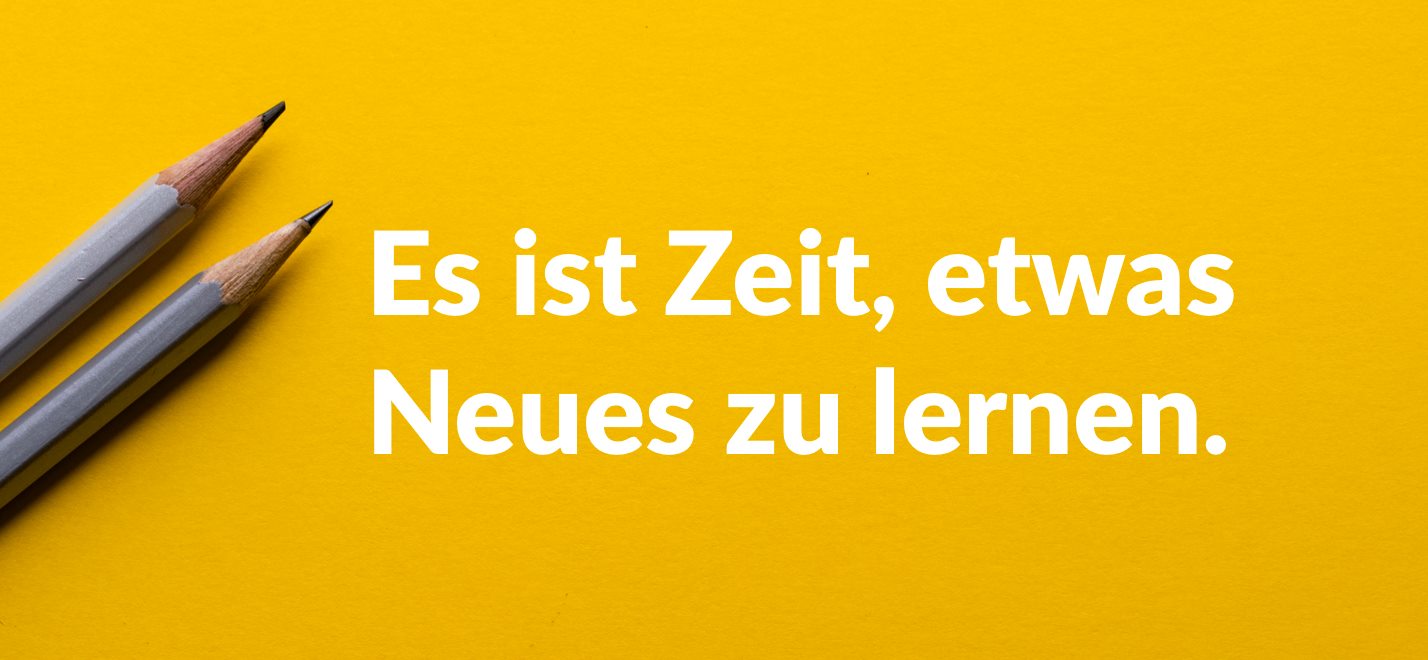Es wurde im Hintergrund fleißig gearbeitet, Usability- und Performance-Tests durchgeführt, Lernende und Lehrende beobachtet, nur mit einem einzigen Ziel: Die erfolgreiche MOOC-Plattform iMooX neu aufzusetzen und damit die Zugänglichkeit zu Bildungsinhalten weiter zu optimieren.
Und wir sind nun stolz darauf nun zu verkünden – es ist soweit. Freuen Sie sich mit uns über das neue Webdesign, die neuen Funktionalitäten und all die Dinge die mit voller Liebe eingebaut wurden. Probieren Sie die neue Plattform aus und melden Sie sich gleich für einen MOOC im Herbst an 🙂 .
Gerade die Anmeldung ist vielleicht die Neuerung schlechthin. Wir bieten ab sofort die Möglichkeit sich mit Hilfe seiner edu-ID anzumelden. Dies bedeutet, wenn man an einer österreichischen Universität studiert oder arbeitet die hier gelistet ist, kann man sich einfach mit seinen Zugangsdaten bei iMooX einloggen – unkompliziert und schnell.
Sollten Sie zu unseren treuen Lernenden gehören, dann haben wir Ihren Benutzernamen übernommen und sie können sich dort einfachen durch einen Klick auf „Passwort zurücksetzen“ wieder einloggen.
Wir wünschen allen viel Freude beim Lernen mit iMooX: „Es ist Zeit, etwas Neues zu lernen“ 🙂